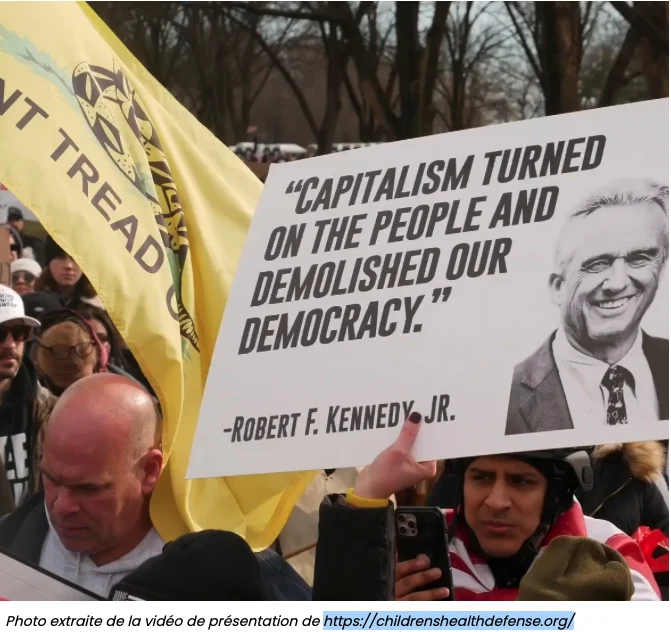In zwei Wellen haben die Proteste gegen die unsoziale Politik Frankreichs in jüngster Zeit wieder an Fahrt aufgenommen. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Demonstrationen gegen die Arbeitsmarkt- und Rentenreformen organisiert, die ihren Höhepunkt am 7. März 2023 erreichten, als nach Schätzungen der Gewerkschaften 3,5 Millionen Menschen gegen die Rentenreform protestierten. In diesem Jahr haben bereits zwei landesweite Aktionstage stattgefunden: der erste am 10. September unter dem Motto „Bloquons tout!“ („Lasst uns alles blockieren!“) und der zweite am 18. September unter dem Motto „Les sacrifices pour le monde du travail, ça suffit!“ („Genug der Opfer für die Arbeitswelt!“). Neben den Demonstrationen und Blockaden fanden zahlreiche Streiks statt, insbesondere am zweiten Aktionstag. Diesen Mobilisierungen ging die dramatische Niederlage der französischen Regierung bei der Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung am 8. September voraus, die den von Präsident Macron neu ernannten Premierminister an die Spitze einer geschäftsführenden Regierung stellte.
Quelle: Etos Media, 26. September 2025, Armin Duttine
Streiks an der Basis und Gewerkschaftsstrukturen
Im Vergleich zu Deutschland haben Streiks in Frankreich oft ihren Ursprung an der Basis und werden auf lokaler Ebene in so genannten Generalversammlungen beschlossen, an denen auch nicht gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer teilnehmen können. Mit nur etwa 10 % gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern hat Frankreich einen der niedrigsten gewerkschaft-lichen Organisationsgrade in Europa, obwohl die Gewerkschaftsmitgliedschaft im öffentlichen Sektor höher ist. Im Gegensatz zu Deutschland haben die Arbeitnehmer in Frankreich ein individuelles Streikrecht, auch für politische Ziele. Außerdem gibt es in Frankreich kein einheitliches Gewerkschaftssystem, das mit dem deutschen DGB vergleichbar wäre, sondern eine Vielzahl von oft politisch unterschiedlichen Gewerkschaftsbünden. Linksgerichtete Gewerkschaften – CGT (der zweitgrößte Gewerkschaftsbund und der größte im öffentlichen Sektor), Solidaires und FSU (hauptsächlich im Bildungswesen), manchmal zusammen mit CGT-FO – organisieren häufig gemeinsame Aktionen, vor allem während der vergangenen Kämpfe gegen die Renten- und Arbeitsrechtsreform. Gelegentlich kommt es zu breiteren Koalitionen, wie am zweiten Aktionstag in diesem Jahr, als sich auch gemäßigte Gewerkschaften wie CFDT (der formell größte Gewerkschaftsbund), UNSA, CFE-CGC (für Manager) und die christlich orientierte CFTC den Mobilisierungen anschlossen.
Erster Aktionstag: 10. September
Der erste Tag orientierte sich an dem Aufruf zu Blockaden, den anarchistische Kreise 2016 während der Arbeitsreform von Hollande gestartet hatten und der sich vor allem über soziale Medien verbreitete. Die Bewegung erhielt schnell Unterstützung von La France Insoumise (LFI, Frankreich ungebeugt) und von lokalen Gewerkschaftszweigen der CGT, Solidaires und CGT-FO. Einige ganze Gewerkschaftssektoren riefen ebenfalls zu Aktionen auf, darunter die CGT-Verbände für das Gesundheits- und Sozialwesen, die Kommunalverwaltung und die chemische Industrie. Während die beiden Aktionstage im September zunächst als konkurrierende Initiativen diskutiert wurden, unterstützten die CGT und viele ihrer Verbände beide.
Am 10. September gingen bis zu 250 000 Menschen auf die Straße. Die Demonstrationen fanden landesweit statt, auch in kleineren Städten, am stärksten jedoch im politisch linksgerichteten Westen Frankreichs. Die Streiks betrafen Dienstleistungen wie den öffentlichen Nahverkehr in Paris, die Wartung der SNCF-Bahn und das Bildungswesen, wobei CGT und Solidaires eine führende Rolle spielten. Da in Frankreich mittwochs wegen der Schulzeiten weniger gearbeitet wird, konnten viele Beschäftigte individuell teilnehmen. Neben Gewerkschaftsmitgliedern nahmen auch Anhänger der LFI, autonome Gruppen (einschließlich Demonstranten vor dem Sitz der CGT), ehemalige Gelbwesten, Studenten und Schüler teil. Ein Großteil der Mobilisierung wurde von jüngeren Teilnehmern getragen, insbesondere durch Schul- und Universitätsblockaden. Die Blockadeaktionen wurden jedoch von den 80.000 eingesetzten Polizisten und Gendarmen schnell aufgelöst.
Zweiter Aktionstag: 18. September
Am zweiten Streik- und Aktionstag war die Beteiligung wesentlich höher: Gewerkschaftsquellen sprechen von rund 1 Million Teilnehmern – doppelt so viel wie am ersten Tag. Ende August riefen die Dachverbände CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU und Solidaires gemeinsam zur Mobilisierung auf und deckten damit fast das gesamte Gewerkschaftsspektrum ab. Auch Studenten und Schüler beteiligten sich und blockierten zahlreiche Einrichtungen. Streiks des Lehrpersonals waren weit verbreitet; nach Angaben der FSU-Gewerkschaften streikten ein Drittel der Grundschullehrer und rund 45 % der Lehrer an Mittel- und Oberschulen. In Toulon verbanden die Demonstranten ihre Proteste mit Solidaritätsaktionen für zwei Schüler, die während einer Schulblockade festgenommen worden waren. Die Demonstranten verbanden den Kampf gegen die Sparmaßnahmen auch mit der Forderung nach Frieden, insbesondere im Gazastreifen, indem sie bei den Demonstrationen palästinensische Fahnen hissten. Der Marsch in Grenoble beispielsweise stand unter dem Motto: „Contre la casse sociale, pour la paix, l’égalité et la justice!“ („Gegen Sozialabbau, für Frieden, Gleichheit und Gerechtigkeit!“). Große Demonstrationen fanden in Paris sowie im Süden und Westen des Landes statt.
Gewerkschaftliche Forderungen und politische Auswirkungen
Im Mittelpunkt des ersten Aktionstages stand der Widerstand gegen die vom Kabinett von Premierminister Bayrou geplanten Sparmaßnahmen in Höhe von 44 Milliarden Euro. Die teilnehmenden Gruppen forderten öffentliche Dienstleistungen, höhere Löhne und Renten, Steuergerechtigkeit und einen ökologischen Umbau. In dem Aufruf der Gewerkschaften im August, der den Aktionen am 18. September vorausging, wurden zahlreiche Pläne der Regierung abgelehnt: die Abschaffung von zwei Feiertagen, Kürzungen im öffentlichen Dienst, strengere Arbeitsgesetze, eine neue Arbeitslosenreform, das Einfrieren von Sozialleistungen und Beamtengehältern, die Abkopplung der Renten von der Inflation, die Verdopplung der medizinischen Zuzahlungen und sogar die Infragestellung der fünften Woche bezahlten Urlaubs in Frankreich. Sie prangerten auch Steuererleichterungen für Wohlhabende und die 211 Milliarden Euro an Subventionen für Großunternehmen an. Die Gewerkschaften forderten eine ausreichende Finanzierung der öffentlichen Dienste, Maßnahmen gegen die Prekarität, Investitionen in einen fairen ökologischen Wandel und die Reindustrialisierung, Schutz vor Entlassungen, Besteuerung großer Vermögen und Spitzeneinkommen sowie die Rücknahme von Macrons Rentenreform, mit der das Rentenalter auf 64 Jahre angehoben wurde. Eine entsprechende Gewerkschaftspetition hatte Ende August bereits 350.000 Unterschriften erreicht.
Die Gewerkschaften gaben dem neuen Premierminister Lecornu eine Frist bis zum 24. September, um darauf zu reagieren, und warnten, dass bei Nichtbeachtung weitere Streiks und Proteste folgen würden. Eine Fortsetzung ist sehr wahrscheinlich. Es wird bereits über eine Eskalation des Kampfes durch erneuerbare Streiks („grèves reconductibles“) anstelle von eintägigen Aktionen diskutiert. Die Unzufriedenheit mit Macrons Regierung ist weit verbreitet: Zwei Drittel der Bevölkerung lehnen seine Politik ab und fast zwei Drittel fordern seinen Rücktritt, obwohl seine Amtszeit noch bis zum Frühjahr 2027 läuft. Die LFI hat ihre Kampagne auf Macrons Rücktritt und Neuwahlen ausgerichtet, Forderungen, die auf der Straße ein breites Echo fanden. Das Linksbündnis „Nouveau Front Populaire“ (Neue Volksfront), in dem die LFI, die Sozialistische Partei, die Kommunistische Partei und die Grünen zusammengeschlossen sind, ist in dieser Frage gespalten, da die Sozialisten und Kommunisten Offenheit für eine Regierungsbeteiligung signalisiert haben. Im Gegensatz dazu legen die Gewerkschaften den Schwerpunkt eher auf konkrete politische Erfolge als auf Rücktritts- oder Wahlaufrufe.
Die rechtsextreme Rassemblement National (RN) fordert ebenfalls den Rücktritt Macrons und vorgezogene Neuwahlen, aber ihre Rolle bei den Straßenprotesten bleibt ungewiss. Obwohl zunächst befürchtet wurde, dass sich die Rechtsextremen in großer Zahl anschließen würden, hat sich dies nicht bewahrheitet, obwohl die RN in politischen Umfragen weiterhin an der Spitze liegt.
Europäische Dimension
Die französischen Proteste haben auch in Deutschland bereits für Aufmerksamkeit gesorgt. Am 17. September gab der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke eine Solidaritätsbekundung ab: „Der Kampf der französischen Gewerkschaften ist auch unser Kampf: für soziale Gerechtigkeit, für den Schutz und den Ausbau des Sozialstaates, für menschenwürdige Arbeit und für ein Leben in Würde im Alter.“
Da viele europäische Länder, darunter auch Deutschland, ähnliche Sozialkürzungen und Aushöhlungen von Arbeitnehmerrechten vorbereiten, insbesondere im Zusammenhang mit den kriegsbedingten Haushalten, stellt sich die Frage, ob die französische Bewegung den Beginn einer europaweiten Protestwelle markieren könnte. Zu den wichtigsten anstehenden Ereignissen gehören die internationale Friedenskonferenz in Paris am 4. und 5. Oktober 2025 mit gewerkschaftlicher Beteiligung und der für den 16. Februar 2026 geplante Aktionstag des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB).